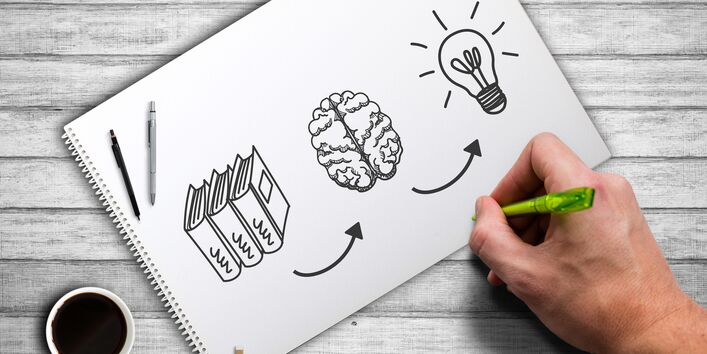Ziele besserer Rechtsetzung
Ein besseres Umweltrecht ist wirkungsvoll, gut vollziehbar und frei von Widersprüchen sowie unnötiger Bürokratie. Das Umweltbundesamt setzt sich dafür ein, das Umweltrecht u. a. dadurch zu verbessern, dass es harmonisiert und vereinheitlicht wird, ohne dass dabei ein angemessener Schutz der Umwelt vernachlässigt wird. Hilfreich können dabei thematisch übergreifende Gesetzbücher, wie ein allgemeines Klimaschutzgesetz oder ein Umweltgesetzbuch sein. Ein übergreifendes Klimaschutzgesetz ist mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) von 2019 geschaffen worden. Es regelt verbindliche Jahresemissionsmengen und Minderungsziele für Treibhausgasemissionen für verschiedene Sektoren bis zur Erreichung der geplanten Klimaneutralität 2045.
Entbürokratisierung
Teil einer besseren Rechtsetzung ist die Entbürokratisierung. Diese zielt darauf ab, überflüssige bürokratische Belastungen, die Rechtsvorschriften bewirken können, für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen und Verwaltung abzubauen. Die Bundesregierung auf nationaler und die Europäische Kommission auf europäischer Ebene verfolgen Programme für bessere Rechtsetzung und Entbürokratisierung.
Das Umweltbundesamt engagiert sich dafür, das Umweltrecht durch Entbürokratisierung effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten und so seine Akzeptanz bei Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zu steigern. Zugleich sind die Ziele des Umweltrechts zu beachten und ein hohes Umweltschutzniveau zu gewährleisten. Ein anspruchsvolles, anwendungsfreundliches Umweltrecht und die Ziele der besseren Rechtsetzung sowie Entbürokratisierung können Hand in Hand gehen.
Ein wichtiges Instrument der besseren Rechtsetzung einschließlich der Entbürokratisierung ist eine Gesetzesfolgenabschätzung, die alle wesentlichen Auswirkungen eines Gesetzes darstellt. Diese umfasst neben dem Erfüllungsaufwand auch den gesamtgesellschaftlichen Nutzen eines Gesetzes. Das Umweltbundesamt verdeutlicht dies in seinem Positionspapier „Bessere Gesetze durch mehr Transparenz der Gesetzesfolgen“. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Normenkontrollrat, welcher die Folgekosten eines jeden von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzes berechnet und den Vorschlag in Bezug auf Rechts- und Verwaltungsvereinfachung überprüft.
Bessere Rechtsetzung und Beschleunigung
Seit 2020 ist im Zusammenhang mit dem Stichwort „Bessere Rechtssetzung“ vor allem die Verfahrens- und Genehmigungsbeschleunigung in den Fokus gerückt. Ziel der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung ist es, die Dauer der Verfahren u. a. durch entsprechende Gesetzesänderungen zu verkürzen. Auch wenn Beschleunigungsbestrebungen an sich nicht neu sind, wurden v. a. innerhalb der 19. und 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages besonders viele Beschleunigungsgesetze verabschiedet. Einige prominente Beispiele hierfür sind u. a. das Plansicherstellungsgesetz (PlanSiG), das Investitionsbeschleunigungsgesetz und das Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz - LNGG).
Mit dem sogenannten „Osterpaket“ sind im Zuge des Wind-an-Land-Gesetzes mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) sowie Änderungen im Baugesetzbuch (BauGB) und Raumordnungsgesetz (ROG) gleich mehrere Beschleunigungsgesetze geschaffen worden, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zur Bewältigung der Klimakrise voranzutreiben.
Die genannten Gesetze sind nur einige Beispiele in der langen Liste der sogenannten Beschleunigungsgesetze. Diese nationalen Beschleunigungsgesetze beruhen teilweise auf Beschleunigungsbestrebungen der EU, die beispielsweise in der Novelle der Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (RED III) und der EU-Notfallverordnung zum Ausdruck gekommen sind. Hintergrund hierfür war neben der angestrebten Erreichung der Klimaziele v. a. die Energiekrise aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die genannten EU-Rechtsakte haben den Ausbau der erneuerbaren Energien und damit die Verbesserung der energetischen Unabhängigkeit der EU von Importen fossiler Energieträger zum Ziel.
Ob diese Gesetze auch tatsächlich den gewünschten Beschleunigungseffekt erzielen, bleibt abzuwarten. Häufige Rechtsänderungen können sich auch verzögernd auswirken, da eine zu schnelle Abfolge von Gesetzesänderungen häufig zu Rechtsunsicherheit führt. Eine Vielzahl kleinteiliger Rechtsänderungen wirken sich zudem negativ auf die Rechtsklarheit, Übersichtlichkeit und Anwendungsfreundlichkeit aus. Sie können also auch das Gegenteil von besserer Rechtsetzung bewirken. Zudem lassen die Beschleunigungsgesetze die Tendenz erkennen, zunehmend Umweltstandards und Beteiligungsrechte zugunsten der Beschleunigung abzuschwächen. So wurden in den letzten beiden Legislaturperioden v. a. Ausnahmen von der Pflicht zur Durchführung von Umweltprüfungen und artenschutzrechtlichen Prüfungen zugelassen sowie Fristen der Öffentlichkeitsbeteiligung verkürzt. Diese sind jedoch wichtige Instrumente zur Sicherung eines hohen Umweltschutzniveaus und der Gewährleistung von Beteiligungsrechten, die für einen demokratischen Rechtsstaat essentiell sind. Bessere Rechtsetzung bedeutet jedoch u. a. einen angemessenen Ausgleich zu finden zwischen dem Bedürfnis nach zügigen und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Verwaltungsentscheidungen.