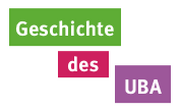EU beschließt Verbot bestimmter Einwegkunststoffprodukte ab 2021
Sie werden meist nur kurz benutzt und landen dann zu oft in der Umwelt, wo sie nicht verrotten: Wegwerfartikel aus Kunststoff, wie Trinkhalme, Wattestäbchen oder Rührstäbchen für den „Coffee to go“. Den zehn am häufigsten an europäischen Stränden gefundenen Einwegplastikprodukten, für die es umweltfreundlichere Alternativen aus anderen Materialien gibt, sagt die Europäische Union (EU) den Kampf an.
Die „Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt“ von 2019 beinhaltet unter anderem ein Verbot des Inverkehrbringens folgender Einwegprodukte aus Kunststoff: Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen und Luftballonstäbe, Becher und Behälter aus expandiertem Polystyrol für Essen und Getränke zum Mitnehmen sowie von Produkten aus oxo-abbaubaren Kunststoffen, die durch bestimmte Zusatzstoffe in der Umwelt schnell in kleinere Stücke zerfallen, die sich dann aber nicht vollständig abbauen. Diese Verbote werden in Deutschland über die Einwegkunststoffverbotsverordnung umgesetzt.
Auch eine Reihe weiterer Regelungen soll die Vermüllung der Umwelt verringern. Zum Beispiel soll der Verbrauch von Einwegkunststoff-Getränkebechern und -essenbehältern verringert werden, vor allem durch den Umstieg auf wiederverwendbare Produkte. Hersteller bestimmter Einwegprodukte müssen sich zudem an den Kosten für die Reinigung der vermüllten Umwelt beteiligen. Die EU-Mitgliedsstaaten haben bis 3. Juli 2021 Zeit, die Vorgaben umzusetzen.